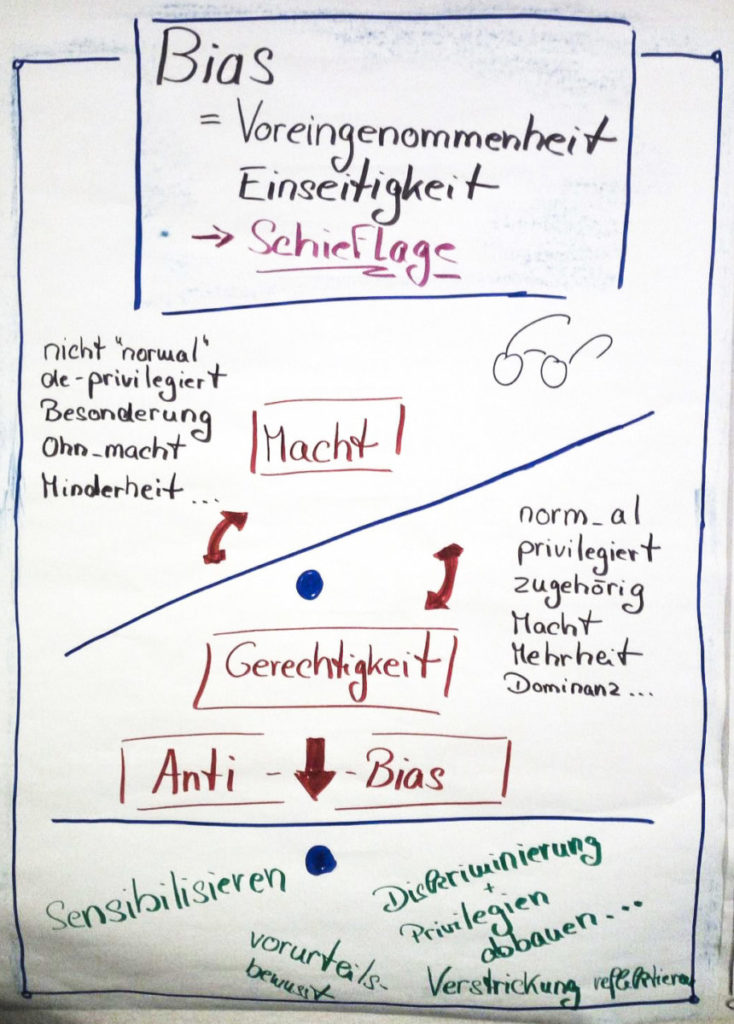Straßenexerzitien sind als neue Form der ignatianischen Exerzitien entstanden…und inzwischen ist es so weit, dass auch diese neue Form weiter verändert und verwandelt wird…und dass sie das auch aushält! Der folgende Artikel von Lutz Müller SJ macht eine solche „Metamorphose“ nachvollziehbar.
In letzter Zeit sind neue Formate in den Straßenexerzitien aufgetaucht. Da kommt beispielsweise Misereor Aachen auf uns Begleitende von Straßenexerzitien zu und fragt, ob wir wohl einen Besinnungstag für ihre Mitarbeitenden gestalten könnten. Ein ausgedehnter geistlicher Impuls für einen Besinnungstag im Advent. Eine Art Schnuppertag, wie er schon von Katholikentagen, Kirchentagen u.ä. bekannt ist. Der dauert sechs Stunden und ist offen für alle Eingeladenen. Bei den Eingeladenen geht es um die Angestellten von Misereor. Sie werden quasi vom Arbeitgeber angemeldet. Da stellt sich sofort die Frage: Geht das überhaupt? Exerzitien auf Anweisung? Straßenexerzitien unfreiwillig??
So ein Tag strukturiert sich in mehrere Phasen: Ankommen, Aussenden, Einsammeln, Gottesdienst.
- Ankommen: Begrüßung, Erklärung der Exerzitien auf der Straße, Einführung spirituell, biblisch, methodisch;
- Aussendung auf die Straße, Zeit auf der Straße;
- Rückkehr zum Ausgangspunkt, Einteilen in Gruppen, Teilen der gemachten Erfahrungen; jeweils ein/e Begleiter/in für etwa 10 Teilnehmende;
- Eucharistiefeier zum Abschluss für alle.
Jede dieser vier Phasen hatte eine eigene Teilnehmendenzahl, d.h. die Zahl war in jeder Phase verschieden groß. Alle hatten die Freiheit, jeweils am Besinnungstag mitzumachen oder aber – falls sie das so nicht wollten – in ihrem Büro zu arbeiten. Dabei war klar: die Teilnahme wurde erwartet, aber wie das genau aussah, entschied jede Person selbst. Das trug der Tatsache Rechnung, dass kein Arbeitgeber seine Angestellte zu einem Besinnungstag verpflichten kann. Auf diese Weise wurde die Freiheit gegeben, sich etwas aus dem „Programmangebot“ auszusuchen. Da taten die Menschen dann auch. Ganz viele (über 100) kamen zur Einführung und zum Gottesdienst. Auf die Zeit auf der Straße liessen sich weniger ein, ebenso auf die Austauschrunde.
Inhaltlich möchte ich nur erwähnen, dass eine Reihe der Teilnehmenden authentische Erfahrungen auf der Straße machten. Damit meine ich, dass sie Begegnungen und Gefühle, Wahrnehmungen und Verhaltensweisen erlebten, wie ich sie normalerweise selbst bei Straßenexerzitien kenne.
Formal bestand die Austauschrunde aus einem Teilen über 60 Minuten, angeleitet von einem oder zwei Begleiter:in. D.h. das ergab sehr wenig Zeit pro Teilnehmenden, es haben auch einige nichts gesagt, was anders auch nicht gegangen wäre.
Beim Abschluß des Tages im Gottesdienst war eine rege Beteiligung vorhanden.
Formate dieser Art mehren sich. Eine Institution erkennt, dass Straßenexerzitien eine positive Erfahrung sein könnte für die eigenen Mitarbeitenden. Jedenfalls hält sie diese „Aktivität“ für eine Bereicherung und sucht sie daher aus. Sie „schickt“ ihre Leute dahin. Damit gilt: Die Teilnehmenden sind nicht richtig freiwillig da, sondern eben mit Einschränkung. Im Fall von Misereor bestand eine Wahlfreiheit. Das machte das Projekt frei: Wer sich nicht oder nur teilweise auf das Abenteuer einlassen konnte oder wollte, hatte sein Büro als Alternative.
Es gibt inzwischen auch andere Stile. Die Organisation der Malteser hat mehrere Curricula der Fortbildung. Eine Art davon – dasjenige für vermutete, potentielle Führungskräfte – ist eine Reihe mit vier Modulen, zu je drei Tagen, wobei ein Modul „Spiritualität“ heißt. Die Fortbildungsabteilung suchte sich dafür die Exerzitien auf der Straße aus. Eingeteilt in Regionalgruppen mit je etwa 10 Teilnehmenden durchläuft dasselbe Team alle vier Module, so eben auch das Modul „Spiritualität“. Damit sind wichtige Parameter verändert, es sind nicht mehr Straßenexerzitien im üblichen Sinn. Die sind die hauptsächlichen Unterschiede:
- Es gibt keine offizielle Alternative zum Programm. Die Teilnehmenden sind mit der Gruppe vor Ort zur Fortbildung. Das Büro in der Herkunftsstadt ist weit weg. Die Teilnahme ist nicht richtig freiwillig, sondern wird wirklich erwartet.
- Die Unterbringung erfolgt in einfachen Hotels, die die Fortbildungsabteilung bucht. Es gibt keine Verbindung zu irgendeiner Kirchengemeinde.
- Die Gruppe kennt sich; wenn nicht schon aus der alltäglichen Arbeit, dann immer aus den (meist) zwei vorherigen Modulen.
- Gerade weil sich die Leute von vorher kennen und sie sich auch nach dem Kurs wieder treffen werden (zum vierten Modul und meist auch im folgenden Arbeitsalltag) besteht ein großes Bedürfnis zum geselligen Treff abends.
- Das Innenleben der Firma ist als unsichtbarer, aber spürbarer Gast mit dabei: interne Hierarchien, persönliche Sympathien, geteilte Vorlieben, gemeinsame Feindbilder, Atmosphäre von Fortbildungen, die Philosophie des Unternehmens usw.
- Der Trainer aus der Fortbildungsabteilung ist dabei. Er leitet die Veranstaltung und liefert Inhalte (dazu gleich mehr), macht aber nicht als Begleiter der Austauschrunden mit.
- Niemand kennt in diesen Kontexten „geistliche Begleiter:innen“. Die Menschen sind vertraut mit Trainer:innen, Supervisor:innen, Moderator:innen, Referent:innen, Anleiter:innen, Expert:innen usw. Geistliche Begleitung ist völlig neu.
- Kaum jemand kennt Exerzitien aus eigener Erfahrung, dementsprechend ist die Vertrautheit mit religiöser oder spiritueller Sprache sehr unterschiedlich.
Das Setting ist so verschieden, dass wir den Titel änderten. Die Straßenexerzitien in diesem Format heißen hier Großstadtmeditation. Die Namensänderung ist nicht nur formell, sondern wirkt sich inhaltlich aus. Die Vorgehensweise ist nämlich verschieden:
- Es gibt eine Reflexion über den Wertekatalog der Malteser.
- Es gibt eine Einführung in unterschiedliche Dimensionen von Glauben: Existenzglaube, Transzendenzglaube, Konfessionsglaube. Das sind drei grundlegende Formen des Zugehens auf die Wirklichkeit, das sich im Vertrauen auf Natur, Schöpfung, Universum, oder im Glauben an ein höheres Wesen, oder in der Identifikation mit einer religiösen Konfession und ihren Traditionen zeigt.
- Es gibt eine Sensibilisierung mit Aufmerksamkeits- und Atemübungen.
- Gottesdienstformen sind Meditation, Wortgottesdienst und Eucharistiefeier.
- Es ist ausführlich Raum für Stellungnahmen zu Glaubensformen, Gottesbildern und Kirche; und für die Meta-Ebene des Kurses (Umstände, Organisatoren, Rollen usw).
Das sind alles Punkte, die in normalen STREX so gebündelt nicht vorkommen. Entsprechend werden die Großstadtmeditationen mit Methoden der Erwachsenenbildung ergänzt, weil es nicht sofort auf die Straße geht, sondern eine Art Anwärmphase braucht, damit sich möglichst viele auf den Prozess einlassen. Am Anfang des Prozesses steht das gewinnende Einladen der Anwesenden – etwas, das bei normalen STREX vorausgesetzt werden kann. Wenn ich solche Exerzitien begleiten will, muss ich derlei Ambivalenzen aushalten.
Die Großstadtmeditationen sind aus den STREX erwachsen. Sie sind nicht mehr die ursprüngliche Form. Eine Stärke der ignatianischen Exerzitien ist ihre Fähigkeit, an verschiedene Umstände angepasst werden zu können. Ignatius von Loyola, der Begründer von Exerzitien, schreibt: „Diese Übungen müssen je nach der Eignung derjenigen angewandt werden, die geistliche Übungen nehmen wollen.“ (Geistliche Übungen 18a) Die Großstadtmeditationen sind für mich ein Beispiel dafür.